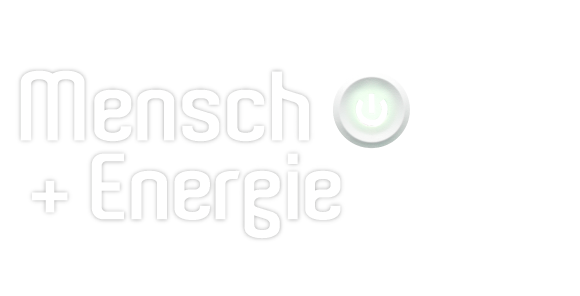Nur gerade knapp 32 Prozent Ja-Stimmen erzielte die «Solar-Initiative» vor 20 Jahren in der Volksabstimmung. Die Initiantinnen und Initianten hatten die Einführung eines halben «Solarrappens» auf eine Kilowattstunde verlangt, der auf Atomstrom und nicht erneuerbare Energien erhoben werden sollte. Die Einnahmen wären gezielt zur Förderung erneuerbarer Energien verwendet worden. Auch der Gegenvorschlag des Bundesrates, der sich mit 0,3 Rappen zufrieden geben wollte, blieb chancenlos, ebenso ein Verfassungsartikel, der eine Energielenkungsabgabe von zwei Rappen pro Kilowattstunde vorsah, die via die Sozialversicherungsbeiträge an Arbeitgeber und Arbeitnehmer zurückerstattet worden wären. Die Gegner dieser Neuausrichtung der Energiepolitik hatten Energiepreise an die Wand gemalt, die namentlich den kleinen Leuten das Leben schwer machen würden. Und die Wirtschaftslobbyisten beklagten beredt Kostennachteile im internationalen Wettbewerb. Die beiden Narrative zählen bis heute zum Standardrepertoire der Gegnerschaft von umwelt- und energiepolitischen Vorlagen.
Es waren gleich drei verpasste Chancen. Dabei war die Schweiz einmal ein Pionierland der Solarenergienutzung gewesen. Wäre der Solarrappen damals durchgekommen, wären bis zum Jahr 2025 über neun Milliarden Franken in die Förderung von Solaranlagen auf Hausdächern und Industrieanlagen geflossen. Das hätte der Schweiz einen Solarboom beschert, der Anteil des Solarstroms an der Stromproduktion läge heute bei einem Mehrfachen der 3,4 Prozent, wie sie 2019 erreicht wurden. Heute ist klar, dass, wenn das Ziel einer klimaneutralen Schweiz bis 2050 erreicht werden soll, Solarkraftwerke mit einer Kapazität von 1,5 Gigawatt jährlich gebaut werden müssten, um die angepeilten 40 bis 45 Terrawattstunden Strom jährlich zu produzieren. Das ist etwa das 25-fache der heutigen Kapazität. Mit den aktuell geltenden Fördermassnahmen ist kaum mehr als ein halbes Gigawatt drin. So gibt es noch viel mehr zu tun, als mit einer weitsichtigeren Energiepolitik vor 20 Jahren nötig gewesen wäre.
Denn den beharrenden Kräften einer Energielobby, die voll auf nukleare und fossile Brennstoffe setzen wollte, war es noch über Jahre gelungen, ihre Interessen in einem Mass durchzusetzen, das die Schweizer Klimapolitik trotz aller Lippenbekenntnisse immer wieder einbremste. So wird das für das Jahr 2020 festgelegte CO2-Emissions-Reduktionsziel von minus 20 Prozent deutlich verfehlt werden. Das liegt fast ausschliesslich an den Emissionen des Verkehrs, der, trotz aller technischen Fortschritte und Abgasvorschriften sich auf dem Niveau von 1990 bewegt, während es etwa im Gebäudebereich gelungen ist, diese um ein Viertel zu reduzieren. Das liegt namentlich an einer im CO2-Gesetz im Jahr 2008 eingeführten Lenkungsabgabe auf fossilen Brennstoffen, für die die Schweiz zurecht international gelobt worden ist. Sie entspricht im Prinzip dem in der Solar-Initiative entwickelten Vorschlag, nur werden die Einnahmen an die Bevölkerung zurückverteilt. Ergänzend wurde ein Gebäudeprogramm zur Sanierung von Altbauten und effizienter Energienutzung auf die Beine gestellt. Diese Lenkungsabgabe hat sich, wie Studien zeigen, als um das Drei- bis Vierfache effizienter erwiesen als der auf Treibstoffen erhobene «Klimarappen», der von den Treibstoffimporteuren eingezogen, in eine Stiftung einbezahlt und für Klimaprojekte im Ausland verwendet wird.
Den Energielobbyisten war es während zwei Jahrzehnten gelungen, den Verkehr von der CO2-Abgabe zu befreien und den unbrauchbaren Klimarappen durchzudrücken. Noch 2018, als im Parlament eine Neufassung des Gesetzes debattiert wurde, war keine Rede davon. Zudem sollten Schweizer Emissionen nach wie vor weitgehend im Ausland kompensiert werden. Das ist zwar billiger und fällt leichter, es hemmt aber zugleich Innovationen und Investitionen im Inland, die mit der abgelehnten Solar-Initiative eingeleitete Blockade einer wahren Energiewende wäre fortgesetzt worden.
Doch dann kam Greta Thunberg, kam die Klimajugend, kamen im vergangenen Herbst die Neuwahlen, und es kam zu einem unerwarteten Grünrutsch: Die Grünen und die wirtschaftsfreundlicheren Grünliberalen erzielten rekordhohe Sitzgewinne, die Rechtsparteien verloren ihre Mehrheit in der grossen Parlamentskammer, dem Nationalrat. Und so kam es zu einer Kehrtwende in der Klimapolitik. Das CO2-Gesetz ist in seiner dritten Fassung nun mehr als ein fauler Kompromiss, man könnte ihn guteidgenössisch nennen, mit einer in vielen europäischen Staaten längst eingeführten Abgabe auf den Flugverkehr, mit einer CO2-Steuer auf Treibstoffen, mit CO2-Emissionen, die zu 75 Prozent im Inland kompensiert werden müssen, und mit einem klaren Ziel: bis 2030 sollen die Klimagas-Emissionen in der Schweiz gegenüber 1990 halbiert werden. Und zwei Jahrzehnte nach der Abstimmung über die Solar-Initiative wird nun auch ein Klimafonds eingerichtet. Er ist mit einer Milliarde jährlich dotiert. Ähnliches hatte vor bald 30 Jahren auch eine Experten-Kommission vorgeschlagen. Der Bericht wurde damals schubladisiert – eine der vielen verpassten Chancen in der Schweizer Klimapolitik.
Nun muss in zehn Jahren nachgeholt werden, was in 30 Jahren weitgehend verpasst worden war. Das wird auch mit dem CO2-Gesetz nur schwer zu schaffen sein. Mehr noch. In dreissig Jahren, 2050, will, muss die Schweiz klimaneutral werden, wenn sie ihre Verpflichtungen im Pariser Klimaabkommen von 2015 ernst nimmt. Das ist ein Ziel, das selbst vom Umweltministerium in einem Fachbericht aus dem Jahr 2018 als nahezu utopisch betrachtet wird. Das hat mit dem übergrossen CO2-Fussabdruck der Schweizer Bevölkerung zu tun. Auf 14 Tonnen pro Kopf belaufen sich aktuell die CO2-Emissionen. Nur sechs Tonnen davon werden im Inland emittiert, acht Tonnen aber im Ausland, in Form von Lebens- und Futtermitteln, die importiert werden, Schuhen, Kleider, Haushaltgeräte und Mobilität. Und die Schweizer Bevölkerung fliegt besonders gerne und besonders weit. Tatsächlich ist der geschrumpfte inländische CO2-Fussabdruck in den letzten 30 Jahren weitgehend auf Kosten des ausländischen CO2-Fussabdruckes reduziert worden. Unter dem Strich ist das ein Nullsummenspiel: 30 verlorene Jahre.
«Während bereits gut vorstellbar ist, wie das Leben in einer 1-Tonne-CO2-Gesellschaft aussehen könnte, ist noch weitgehend unklar, wie die Klimaneutralität in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts erreicht werden soll. Angesichts dieser Unsicherheit ist es umso wichtiger, dass die Treibhausgasemissionen möglichst rasch und umfassend reduziert werden», heisst es in dem Bericht dazu. Das müsste eigentlich Anlass genug zu sein, mit mehr als einem guteidgenössischen Kompromiss in die Klimazukunft zu gehen. Dennoch haben sowohl Grüne, Linke als auch meisten Umweltorganisationen, die sich in der Klimaallianz zusammengeschlossen haben, dem Gesetz zugestimmt, um wenigsten den Spatz in der Hand zu halten. Die in der Aktivistengruppe «Rise Up for Change» zusammengefasste Klimajugend fordert hingegen weiter die Taube auf dem Dach und verlangt, die Klimagas-Emissionen bis 2030 auf Null zu reduzieren. Niemand kann ernsthaft daran zweifeln, dass dieses Ziel nicht zu schaffen ist, doch anderseits kann auch niemand bezweifeln, dass die Forderung berechtigt und auch wissenschaftlich fundiert ist. Man denke nur an die Klimagerechtigtkeit. Wenn man den armen Ländern eine Entwicklung hin zu einer Lebensqualität einräumt, die in westlichen Industriestaaten als selbstverständlich erachtet wird, gibt es nur den Weg über einen sehr raschen Umbau der energieintensiven Gesellschaften. Denn die Klimakrise ist auch eine humanitäre Krise. Alles andere grenzt an Heuchelei. Der zivile Ungehorsam, wie er nun von «Rise up For Change» ausgerufen wird und mit der Besetzung des Platzes vor dem Bundeshaus während der Parlamentsdebatte auch umgesetzt worden ist, hat Tradition. 1975 war das Gelände des geplanten Atomkraftwerks Kaiseraugst besetzt worden. Das AKW wurde nie gebaut.
In der Realpolitik sehen sich die Aktivistinnen und Aktivisten nun mit einem Dilemma konfrontiert, das durchaus auch eine moralische Komponenten hat. Denn das CO2-Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum, mit 50'000 Unterschriften kann eine Volksabstimmung erzwungen werden. Die rechtspopulistische SVP, die wählerstärkste Partei der Schweiz, hatte sich aus ganz anderen Gründen in Totalopposition zum CO2-Gesetz geübt, und bereits wird das Mantra vom Geld, das dem Kleinbürger aus der Tasche gezogen wird, gesungen. Man werde zwar selber kein Referendum anstreben, unterstütze aber jede Gruppierung, die Unterschriften sammelt, hiess es aus der Parteizentrale. Nun haben auch Aktivisten aus der Westschweiz angekündigt, das Referendum zu ergreifen. Eine unheilige Allianz bahnt sich an, und bei den Befürwortern des Gesetzes geht, angesichts einer langen Reihe von Abstimmungsschlappen in umweltpolitischen Fragen, das grosse Zittern los. Ein Scheitern des CO2-Gesetzes an der Urne wäre keineswegs ausgeschlossen.
Das gilt durchaus auch für eine Renaissance der Atomenergie. Zwar ist das erste Schweizer AKW Mühleberg im vergangenen Dezember aus Kostengründen vom Netz gegangen, doch für die verbliebenen drei Atomkraftwerke, darunter eines der ältesten der Welt, gilt die Regel, dass sie solange laufen sollen, als dass sie sicher sind. Ein Neubau ist zwar mit dem neuen Energiegesetz von 2017 verboten, doch wäre dieser Passus mit einer parlamentarischen Mehrheit jederzeit zu streichen - auch wenn eine Referendumsabstimmung dann nahezu sicher wäre. Ein Szenario, das angesichts einer sich zuspitzenden Klimakrise und verfehlter Klimaziele ein Comeback der Atomenergie ermöglich könnte, ist keineswegs utopisch.